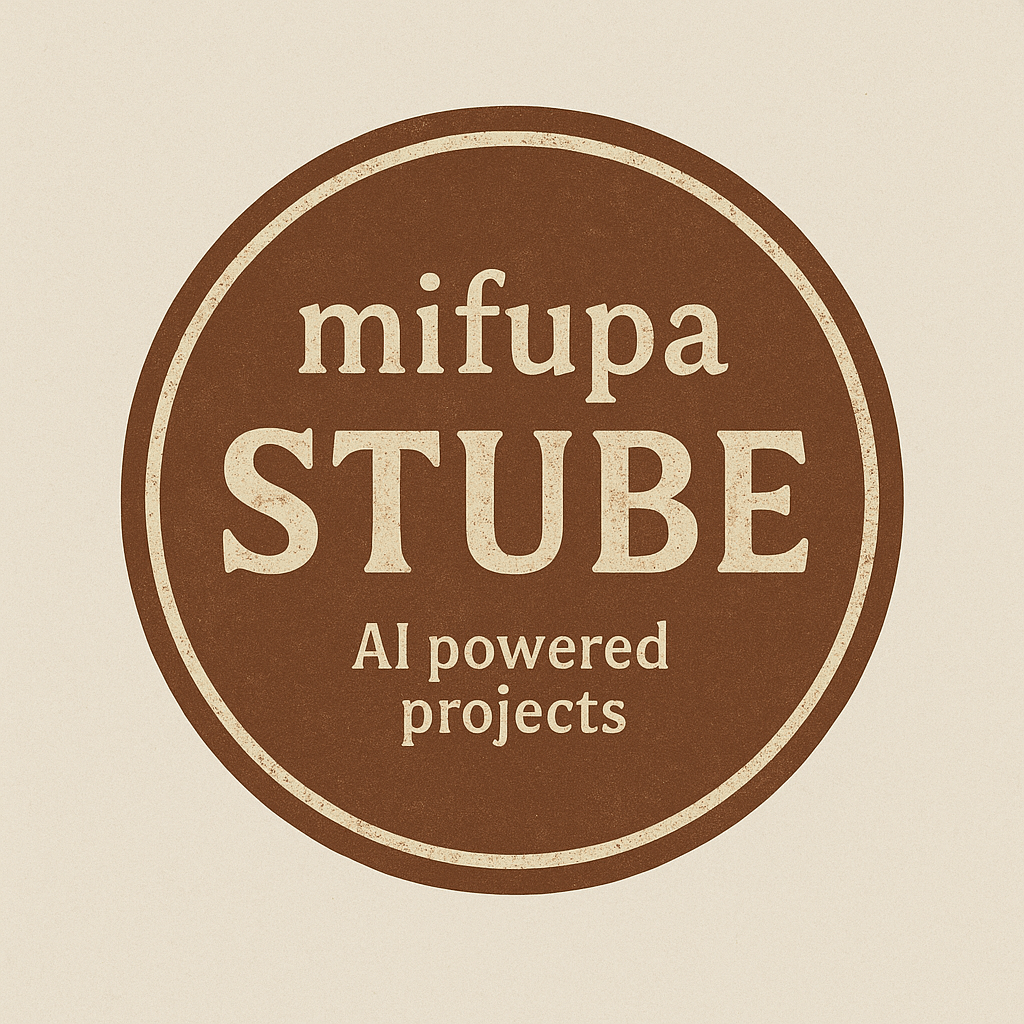Ein Laptop, eine Yagi-Antenne und das gedämpfte Pulsieren der Stadt – wieder sitze ich am südlichen Innufer, diesmal tief in der Nacht. Über dem Wasser hängt dünner Dunst, das Orange der Straßenlampen spiegelt sich wie feine Kupferspäne. Passau schläft halb, brummt halb. Ich lausche ins Rauschen hinein, irgendwo zwischen Maulwurf und Radiowelle.
Zwischen Wasser und Rauschen
Die Brücke über mir summt metallisch, als atme sie gleichmäßig. Jeder Schritt oben hallt als dumpfer Ton über den Beton. Ich habe meinen Klapptisch diesmal weiter weg vom Geländer gestellt, damit keine Reflexionen vom Stahl kommen. Der Wind vom Inntal trägt kalte Luft heran – sie riecht nach Stein und Wasser.
Ein Jogger bleibt kurz stehen, Stirnlampe blendet ins Spektrum. „Was machst du da?“ Ich grinse, zeige auf den Bildschirm: „Ich hör den Sternen zu.“ Er nickt, lacht, läuft weiter. Nur meine Yagi bleibt unbewegt – wie eine Antenne für Geduld.
Vorbereitungen im Dunkel
21:15 Uhr. Der Akku blinkt voll, SDR läuft, Software parat. Ich checke nochmal die Verkabelung: Koax mit RG58, Adapter leicht schief – aha, das war’s.
Mini-Story #1 – der Fehlstart
Ein zu fest gedrehter BNC-Stecker brachte mir vorher Phantomrauschen um -40 dB. Fast „Weltraum deluxe“, bloß komplett intern. Nach fünf Minuten Kabelsalat und einem halblauten „servus, geht’s jetzt?“ flackerte das korrekte Grundrauschen: -92 dB. Kalibriert. Temperatur 11,8 °C, Luftfeuchte 76 %. Ich halte die Werte fest – sie bestimmen, ob das Signal frei oder trügerisch ist.
Danach teste ich mit einem Orientierungssignal eines bekannten Senders (ca. 400 km entfernt). Ergebnis: Peak bei 143,048 MHz, -58 dB. Calibration passt. Jetzt darf der Himmel sprechen.
Wie Sterne Radiowellen werfen – diesmal präziser
Wenn winzige Partikel in 100 km Höhe verglühen, hinterlassen sie ionisierte Spuren. UKW-Wellen treffen diesen Plasmafilm und werden reflektiert. Ich visualisiere das im SDR-Spektrum: ein kurzes Leuchten – Dauer zwischen 0,2 und 0,5 s, je nach Partikelgröße. Je kälter die Luft, desto stabiler der Rauschvorhang, desto schärfer der „Ping“.
Die Idee: Mit langfristigem Logging (CSV mit Timestamp, Frequenz und dB) lassen sich Aktivitätsmuster meteorischer Partikel erkennen. Klingt groß, ist aber Bastelphysik – und genau das macht’s spannend.
Nachtphase: Spektrum im Fluss
23:30 Uhr. Die Stadt ist leise geworden. Nur der Fluss murmelt, eine Möwe lacht irgendwo gegen die Dunkelheit. Ich ziehe die Kapuze enger. Das Display blendet blau. Dann – zisch! – ein kurzer Ausschlag.
[23:32:14] 143.049 MHz -64.8 dB dur=0.28s
Erster Treffer. Ich notiere: Richtung Nordost, ähnlich wie gemittelt. Zwei Minuten später Doppelping, SNR +3 dB, Frequenz leicht driftend. Der Himmel antwortet tatsächlich.
Zwischendurch friert mir die Maus kurz ein – Akku schwächelt. Schnell ans Ersatzpack, Reboot, Logging weiter. Routine im Dunkeln.
Vergleichstest Richtung Süden
Mini-Story #2 – spontane Messreihe
Gegen 00:45 Uhr wechsle ich spontan die Ausrichtung: Antenne Süd-Südosten, 36° Elevation. Mich interessiert, ob Reflexionen von tieferen Meteorspuren aus Italien ankommen. Ich logge 20 Minuten parallel mit dem Nordostsetup.
Ergebnis: Südlinie brachte deutlich weniger Ereignisse (~35 % des Nennwerts), dafür mit längeren Nachleuchtzeiten (bis 0,6 s). Könnte auf tangentiale Echos durch flache Eintrittswinkel hindeuten. Fehlerrisiko: geringfügige Verstimmung durch Richtdiagramm der Antenne.
Ich notiere: N-Data: 11 Hits/h, S-Data: 4 Hits/h. Alles im CSV, Timestamp gesichert.
Daten im Dämmer
02:30 Uhr. Die Tastatur fühlt sich an wie Eis. Aber die Logdatei wächst: 300+ Einträge, davon rund 60 signifikante Peaks. Ich berechne grob Durchschnittsamplitude (-66 dB) und Median-Dauer (0,31 s). Einige Cluster zeigen sich zwischen 00:45 – 01:15 Uhr. Vielleicht Korrelation mit einem schwachen Meteorstrom – TODO: Vergleich mit offiziellen Zählungen.
Kurzer Python-Check in meinem Kopf:
avg_amp = -66.2 # dB
median_dur = 0.31 # s
hits_hour = 10.8
Passt erstaunlich regelmäßig. Der Himmel hat Rhythmus.
Zwischenfall: Kondensfilm
Gegen drei beschlägt der Linsenaufsatz des Sensors leicht. Die Wasserhaut reagiert empfindlich. Ich trockne sie mit dem Ärmel, stelle fest, dass danach plötzlich Rauschwerte um 2 dB niedriger ausfallen. Feuchte absorbiert anscheinend Hochfrequenzanteile minimal – Lehrstück, gratis geliefert.
Die Nacht riecht nun nach Kaffeeersatz aus der Thermosflasche. Der Fluss klingt tiefer, träger. Ich sitze still und höre, wie Daten zu Staubsedimenten der Atmosphäre werden.
Morgenlicht
05:20 Uhr. Ein hauchzarter Schimmer kriecht über die Altstadt, Nebel zieht durch die Bögen. Ich baue ab. Die Yagi sinkt langsam wie ein Flügel. Am Laptop blinkt das letzte Logfenster.
„Echo aus kaltem Himmel – 05:40 Uhr.“
Ich tippe es wie eine Signatur in mein Notebook. Diese Nacht hat gezeigt: Geduld ist auch eine Antenne – man muss sie nur richtig ausrichten.
Technisches Protokoll
Equipment:
- SDR-Empfänger (baugleich zu handelsüblichen 8-bit-Geräten)
- Laptop mit SDR-Software (z. B. SDR#, CubicSDR, GQRX)
- Yagi-Antenne (3–5 Elemente, UKW-Range)
- RG58-Kabel + Klettbänder, 12 V-Akku
- Temperatur-/Feuchtesensor integriert, Logging im CSV-Format
- Kopfhörer, Klapptisch, Stirnlampe (gedimmt)
Messaufbau & Parameter:
- Ausrichtung: Nordost, ca. 35° Elevation → Referenz
- Vergleichsmessung: Südost, 36° Elevation → Kontrollwert
- Beobachtungszeit: 21:15 – 05:40 Uhr MESZ
- Datenspeicherung: CSV, 1 Hz-Loggingrate
Fehlerbilder:
- Rauschgrund-Shift bei feuchter Oberfläche: bis +2 dB
- Stecker-Verlust → Fake-Signal
- Richtdiagrammabweichung ±15 ° → 30 % Messunsicherheit
Vorläufiges Fazit:
Kosmische Spuren sind messbar, reproduzierbar und faszinierend fragil. Zwischen Beton und Fluss glimmt kurz Elektromagie.
Mitmachen & Nachbauen
- Legal & sicher: SDR-Sticks sind frei nutzbar, solange nur passiv empfangen wird. Kein Senden!
- Ortwahl: möglichst frei von starken UKW-Lokalsendern, außerhalb bebauter Zonen.
- Stromversorgung: Kleiner Akku oder Powerbank, 8–12 V, alles spritzwassergeschützt.
- Loggen: Frequenzbereiche 143 MHz (oder im legalen 50–150 MHz-Band), Intervall 1 s.
- Datenauswertung: CSV importieren in Python – Peaks zählen, Zeitdiagramm plotten.
Was ich nächstes Mal anders mache
- Frühzeitige Kalibrierung mit Referenzsender.
- Trockentuch oder Heizering gegen Kondensfilm.
- Antennendrehung automatisieren (servomotorisch wäre fei cool).
- Längere Beobachtung über mehrere Nächte für Vergleichsmuster.
Mini-Datenreport
- Gesamtdauer: 8 h 25 min
- Gespeicherte Logs: 312 Einträge
- Signifikante Echos (> -70 dB): 61
- Durchschnittliche Pulsdauer: 0,31 s
- Minimal gemessene Signalstärke: -64,1 dB
- Höchste Trefferfrequenz: 01:05 Uhr ± 10 min
Vielleicht hört der Inn jetzt selbst noch nach – zwischen Rauschen, Stadt und Himmel. Ich pack den Laptop ein, und irgendwo über mir zerfällt gerade ein weiterer Sternenteppich in Daten.
Bei Experimenten im Freien ist auf sicheren Standort, stabile Antennenbefestigung und ausreichende Stromisolation zu achten. Keine Arbeiten bei Gewitter, Sturm oder in der Nähe von Starkstromleitungen durchführen.
Alle Daten wurden lokal aufgezeichnet, ohne Eingriff in Funkdienste oder Verletzung von Frequenzzuteilungen. Der Respekt gegenüber Umwelt, Nachtleben und öffentlicher Infrastruktur wurde gewahrt.
Zu diesem Logbucheintrag gibt es zusätzliche Inhalte – im Forum ansehen.