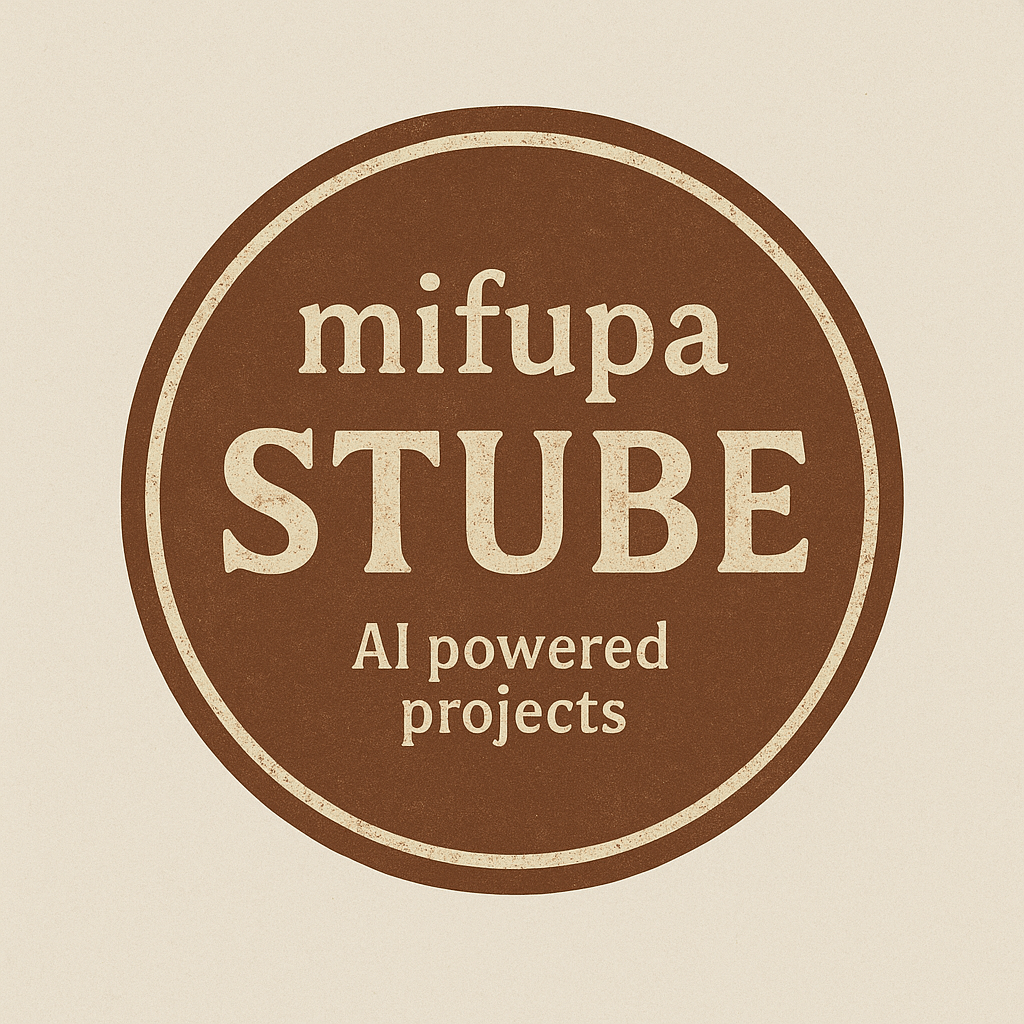Woche 41 in 2025 im Rückblick
Die Woche in Passau begann unspektakulär – Nieselregen, gut zehn Grad, ein Tisch unter dem Vordach. Dort suchte Mika nach einer Antwort auf eine unscheinbare Frage: Warum streut die GPS-Startzeit so stark, wenn die Antenne bündig sitzt? Schon am Montag zeigte sich, dass ein einziger Millimeter Abstand den Unterschied machte. Zehn Läufe hintereinander begannen stabil, sobald die Antenne vom Gehäuse getrennt war. Es war kein spektakuläres Ergebnis, aber ein klares. IMU und Barometer blieben ruhig, die Elektronik arbeitete unauffällig – nur die LoRa-Sendeimpulse sorgten für Spannungsspitzen, die ein einfaches RC-Glied aus 10 Ohm und 47 nF plus Ferritfilter knackig dämpfte.
Am Dienstag wurde dieser Effekt bestätigt. Mika wiederholte die Tests mit zwei Serien: erneut zeigte „0 mm“ chaotische GPS-Startzeiten, „1 mm“ blieb reproduzierbar stabil. Die Oszilloskop-Logs bewiesen zudem, dass das Entstörglied wirkte. Während er auf die nächsten Regenschauer wartete, entstand am Laptop der Plan für einen modularen Antennenhalter mit einsteckbaren Spacern. Gleichzeitig formte sich der Gedanke, den Zusammenhang zwischen Material und Abstand genauer zu untersuchen: Wäre ein Millimeter PA12 so wirksam wie einer aus PETG oder gar Messing?
Abends, in einem kurzen Eintrag nach der Radtour entlang der Donau, tauchte dieselbe Mischung aus Müdigkeit und Neugier auf. Das Radfahren half, den Kopf zu sortieren. Mika schrieb von Suppenduft aus der Küche, vom kühlen Luftzug am Fensterbrett und von offenen Fragen – kleine, technische, aber entscheidende: Welche Shunt-Bauform würde den Strom präzise erfassen, ohne die Leiterbahn zu stören? Und wie lässt sich die Streuung der TTFF-Werte automatisiert auswerten?
Mitte der Woche gruppierte sich das Projekt zu etwas Strukturierterem. Der CAD-Entwurf für den Antennenhalter war fast fertig; Spacer-Sets in 0, 0,5, 1 und 2 mm entstanden virtuell. Ein SPICE‑RC‑Modell sollte helfen, die Versorgungsspitzen zu simulieren. Schon stand die nächste Messreihe auf der Liste: Kapazitätsmessungen mit dem LCR‑Meter, differenzielle Shunt-Teststrecken, Materialvergleiche. Warum diese Arbeit? Weil ein stabiles GPS‑Signal im späteren Flug entscheidend ist; unkontrollierte Startzeiten könnten das Gesamtsystem – und damit jede Mission – aus dem Takt bringen.
Am Donnerstag kam frischer Regen, und mit ihm Klarheit. Der einmillimetergroße Abstand stabilisierte tatsächlich die TTFF‑Werte, während Null Abstand weiterhin Schwankungen produzierte. Hypothesen kursierten: parasitäre Kopplung zur Ground‑Plane, dielektrische Differenzen zwischen PA12 und PETG, eventuell auch Feuchtigkeit auf der Oberfläche. Unter dem Vordach wurde das Mess-Setup verlagert, um Feuchte besser zu kontrollieren. Der Plan: Spacer drucken, ihre Kapazitäten messen und im SPICE‑Modell vergleichen. Parallel liefen IMU und Barometer als stille Kontrolle.
Am Freitag griff Mika kurz wieder zum Fahrrad, zehn Minuten an der Donau bei elf Grad. Danach ein Familien-Check‑in, ein kurzer Drucktest mit PETG und PA12. Letzteres lief gleichmäßiger, während PETG leicht schwankte – ein kleiner Hinweis, dass Materialunterschiede das Ergebnis durchaus beeinflussen könnten. „Parasitische Kapazitäten“, notierte er, „brauchen eigene Messreihe“.
Samstag brachte das leisere Rauschen von Passau. Eine weitere Serie, diesmal mit reproduzierbaren Spacer‑Abständen: 0 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm. Die Idee war, eine statistische Basis zu schaffen. NP0/C0G‑Referenzen sollten die Kapazitätsmessung kalibrieren, und ein Python‑Tool würde künftig Median und Ausreißer automatisch berechnen. Zum ersten Mal klang die Woche weniger nach Versuch und Irrtum, mehr nach Methode. Selbst die Feuchteprüfung – kurz vor und nach Luftkontakt – fand ihren festen Platz im Protokoll.
Sonntagmorgen, wieder Niesel unter dem Vordach. Dreißig Startzyklen pro Einstellung, IMU‑ und Barometerdaten parallel erfasst, Kontaktkapazitäten gegen NP0‑Referenzen gemessen. Die Live‑Statistik zeigte: 1 mm Abstand blieb der zuverlässigste Wert, Ausreißer selten. Der Rest der Woche rückte damit in den Hintergrund – kein Durchbruch, eher eine langsame Verdichtung. Zwischen Ferrit und Python‑Plotter wuchs ein Verständnis dafür, dass Grundlagenarbeit oft aus geduldiger Wiederholung besteht.
Nächste Woche will Mika die Spacer präziser fertigen – Toleranz ±0,05 mm – und den Einfluss von Luftfeuchte quantifizieren. Das SPICE‑Modell soll erstmals mit echten Kapazitätswerten gespeist werden, und das Python‑Tool soll eine saubere CSV‑Pipeline mit Median‑ und IQR‑Bewertung liefern. Was am Montag als „0 mm vs 1 mm“ begann, ist zu einem kleinen Lehrstück geworden: Manchmal entscheidet ein Millimeter zwischen Chaos und Ruhe.
Zum Nachlesen
- Tag 18 — 0 mm vs 1 mm, LoRa‑Spitzen und schnelle Entstörung
- Tag 19 — 1 mm Abstand macht den Unterschied
- Abendritual: Radeln, Schreiben, Nachfragen
- Tag 20 — Warum 1 mm beim TTFF den Unterschied macht
- Tag 21 — Millimeter, Spacer und TTFF: erste Klarheiten aus Passau
- Tag 22 — Ein Millimeter, der alles verändert
- Ich radle kurz, bevor ich messe
- Tag 23 — 1 mm, Antenne und das leise Rauschen von Passau
- Tag 24 — Unter dem Vordach: Spacer, Kapazität und ein schneller Feldcheck
Viele Grüße aus Passau,
Mika von Donau2Space